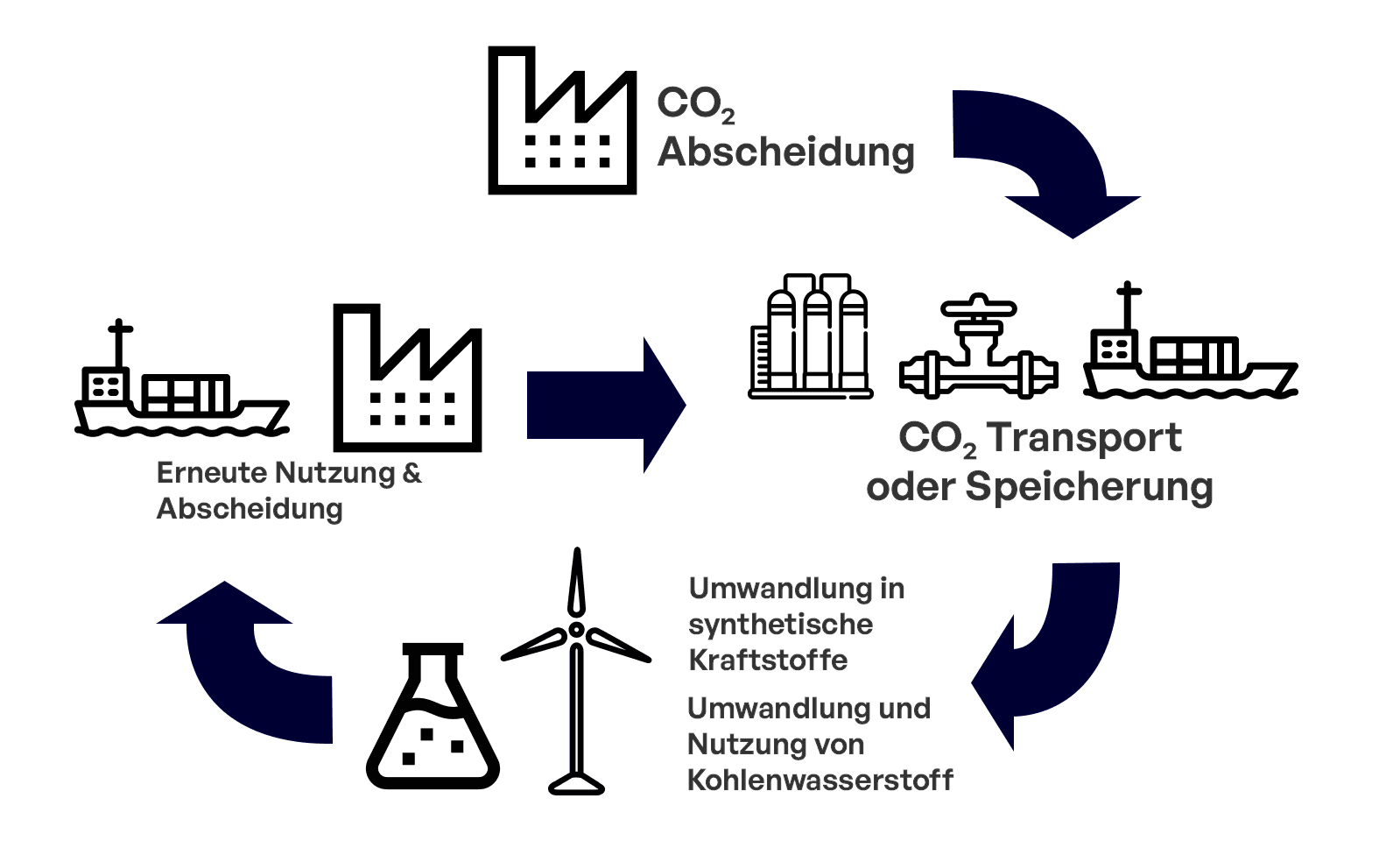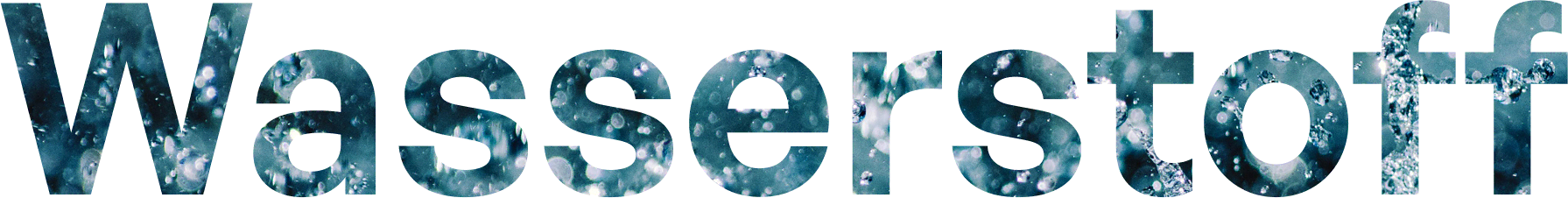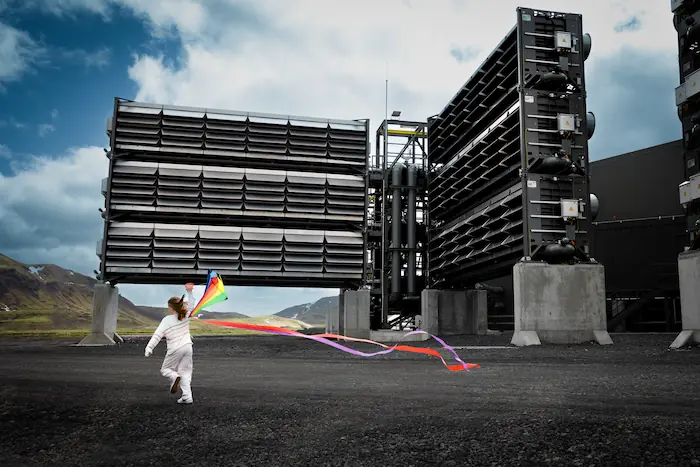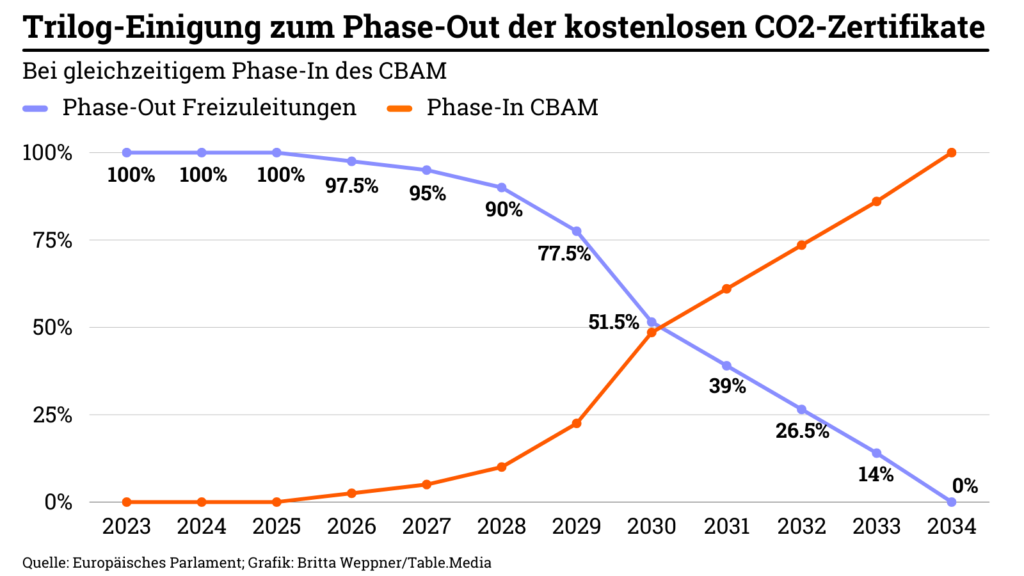Netzbetreiber
Die Errichtung einer Transportinfrastruktur für CO₂ ist eine Infrastrukturaufgabe, die finanziert werden muss. Aus staatlichen Mitteln wird dies allein nicht zu leisten sein. Um private Akteure in die Lage zu versetzen, an der bedarfsgerechten Errichtung der Infrastruktur mitzuwirken, bedarf es einiger grundlegender Weichenstellungen, die frühzeitig getroffen werden sollten.
Zuständigkeit
Es ist unklar, wer die Aufgabe der Errichtung (und des Betriebs) der Infrastruktur künftig übernehmen soll. Wir plädieren für rechtliche Strukturen im Sinne eines Ordnungsrahmens, die es verschiedenen Marktteilnehmern der Energiewirtschaft ermöglichen, privatwirtschaftlich bei Errichtung und Betrieb zu agieren.
Dies bedeutet auch, konzeptionelle Überlegungen zum Gesamttransportnetz und zu den Teilkomponenten zu erarbeiten, um deren Umsetzung durch verschiedene Beteiligte in aufeinander abgestimmten Schritten zu ermöglichen.
Investitionsfähigkeit
Private Investitionen in Infrastruktur funktionieren dann, wenn Angebot und Nachfrage vorhanden sind. Insoweit, vergleichbar mit dem Vorhaben des „Wasserstoff-Kernnetzes“, ist zu berücksichtigen, dass erhebliche Vorleistungen von privaten Unternehmen nur dann erfolgen können, wenn eine spätere Amortisation der Investitionen möglich ist. Dies erfordert hinreichend konkrete Erlösaussichten, die – vermutlich kumulativ mit initialen CAPEX-Förderungen – ausreichen, um die Investitionen zu refinanzieren. Bei den Erlösaussichten spielen Fragestellungen wie die Preisgestaltung (sowohl in der Ramp-up-Phase als auch nach Etablierung eines Marktes) eine bestimmende Rolle. Es sollte dringend überprüft werden, ob die für die Finanzierung des Wasserstoff-Kernnetzes gewählten Instrumente tauglich sind, um eine CO₂-Transportinfrastruktur aufzubauen.
Es ist nachvollziehbar, dass derzeit noch kein Entgeltmechanismus für die Netznutzung vorgegeben wird. Erforderlich sind aus Sicht der Privatwirtschaft jedoch belastbare Aussagen, in welche Richtung die Infrastruktur entwickelt werden soll.


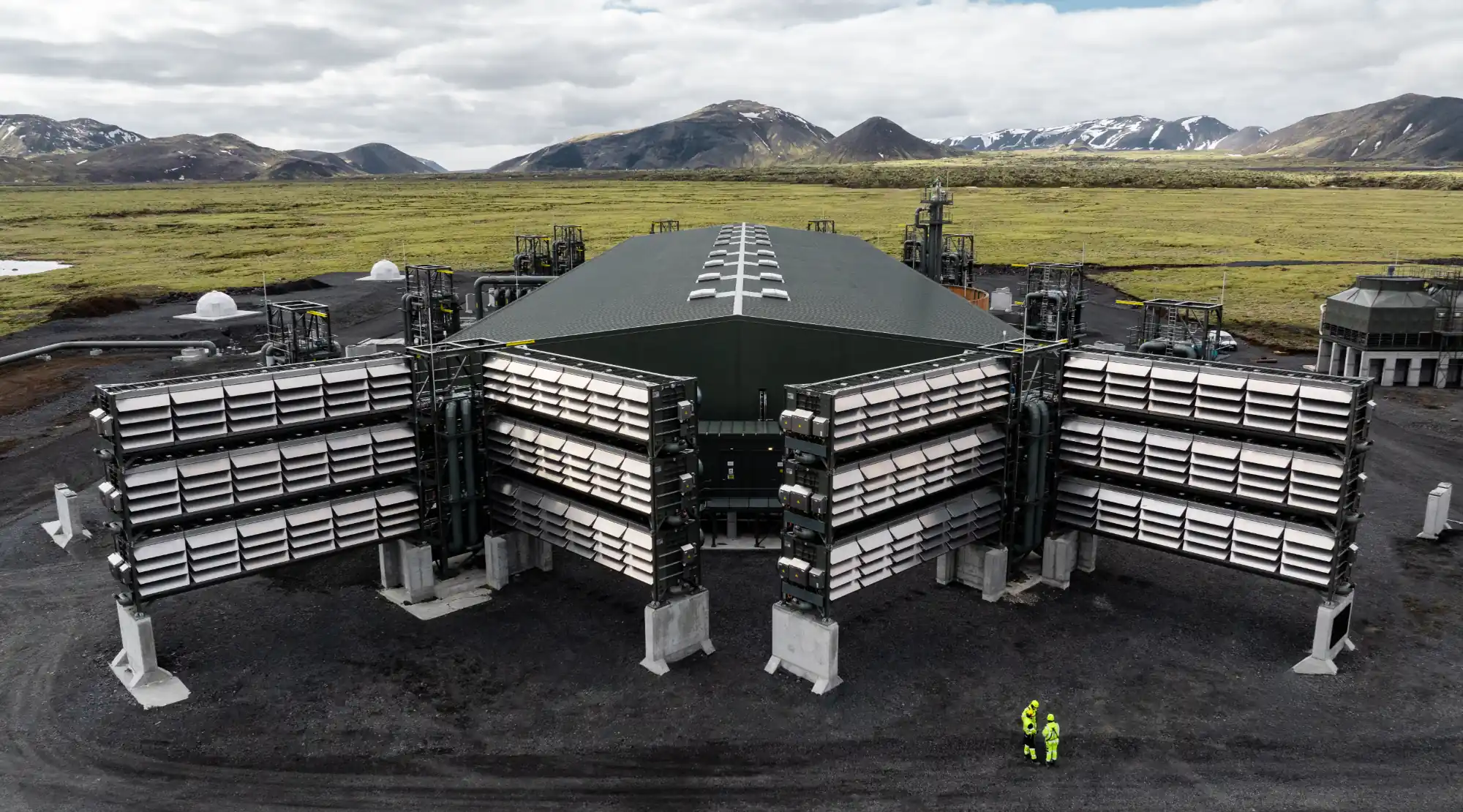


.svg)